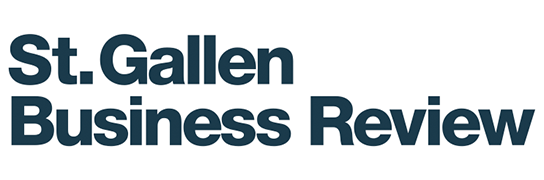Wie würden Sie den Kern von Private Assets und die strategische Ausrichtung des Unternehmens beschreiben?
Private Assets ist eine operativ ausgerichtete Beteiligungsgesellschaft. Das merkt man sofort daran, dass unser Senior Management nahezu ausschliesslich aus dem Operations-Bereich kommt. Wir haben im Management keine reinen Private-Equity- oder Banking-Profile, weil unser Anspruch ein anderer ist. Wenn wir ein Unternehmen übernehmen, wollen wir ein aktivistischer Gesellschafter sein, der wirklich versteht, wie das Unternehmen funktioniert.
Dafür reicht es nicht, nur die Bilanz zu kennen oder die Finanzierungsstruktur zu analysieren. Man muss nachvollziehen können, wie die Wertschöpfung zustande kommt und wo sie verloren geht. Dieser Fokus prägt unsere gesamte Arbeit, ob wir nun einen Carve-out zu einem eigenständigen Unternehmen entwickeln oder ein bestehendes mittelständisches Unternehmen durch einen Transformationsprozess führen.
Sie haben sich früh entschieden, unternehmerische Verantwortung zu übernehmen und eine eigene Private-Equity-Gesellschaft aufzubauen. Was hat Sie ursprünglich zu diesem Schritt motiviert?
Im Kern bin ich seit den 1990er-Jahren in der Transformation und Restrukturierung mittelständischer Unternehmen unterwegs. Studiert habe ich in Berlin zur Zeit des Mauerfalls. Parallel habe ich als Student bei einer Beratung gearbeitet, die Sanierungsgutachten für ostdeutsche Unternehmen erstellt hat. Die Treuhandanstalt musste damals entscheiden, was mit diesen Betrieben passiert. Die Gutachten waren weniger umfangreich als heutige S6-Gutachten, aber die Fragen waren die gleichen: Hat das Unternehmen eine Zukunft? Ist es wettbewerbsfähig? Welche Massnahmen wären nötig?
So bin ich in das Thema Unternehmenssanierung hineingewachsen. Nach einem kurzen Ausflug in den Konzern bin ich zur Beratung zurück, zunächst in die klassische Sanierungsberatung. Ende der 1990er-Jahre entwickelte sich dann zunehmend die CRO-Rolle. Damals hiess sie noch nicht so, aber es ging um die Erkenntnis, dass bei Restrukturierungen häufig der «Fisch vom Kopf her zu stinken beginnt». Inhaber waren oft nicht bereit oder nicht in der Lage, harte Entscheidungen zu treffen. Manchmal brauchte es allein deswegen jemanden von aussen.
Ich erinnere mich an einen Fall mit 800 Mitarbeitern in einem Ort mit 1250 Einwohnern. Wenn klar ist, dass 200 gehen müssen, dann ist das für einen Unternehmer schwierig, weil er diesen Menschen jeden Sonntag beim Brötchenholen begegnet.
2007 habe ich dann das erste Mal für ein Private-Equity-Unternehmen eine Restrukturierung eines mittelständischen Unternehmens verantwortet, hatte aber nur eine kleine Beteiligung an dem Unternehmen.
2012 habe ich deshalb begonnen, mich mehrheitlich an Unternehmen zu beteiligen. Daraus entwickelte sich Schritt für Schritt Private Assets, seit Ende 2020 in der heutigen Form.
Gibt es starke Parallelen zwischen den klassischen Sanierungsthemen Ihrer Anfangszeit und den Herausforderungen, mit denen Unternehmen heute konfrontiert sind?
Die Grundthemen bleiben erstaunlich konstant. Es gibt den alten Spruch: Kosten runter und Umsätze hoch, dann wird es schon. Aber was sich wirklich verändert hat, ist die Einstellung vieler Mitarbeiter zur Arbeit.
Work-Life-Balance spielt heute eine viel grössere Rolle. Wir hören überall Klagen über hohe Kosten und Inflation, aber im Tariflohnbereich entscheiden sich trotzdem 80 % für Freizeit statt Geld, wenn beides zur Wahl steht. Vor 15 Jahren wäre es wahrscheinlich genau umgekehrt gewesen.
Führungskräfte berichten uns, dass die Bereitschaft, Mehrarbeit zu leisten, massiv gesunken ist. Vor 15 Jahren hätte man vermutlich 80 % Zustimmung bekommen, wenn man gesagt hätte, wir brauchen einen Beitrag, der bedeutet, dass ihr drei bis vier Stunden pro Woche mehr arbeitet. Heute wären es vielleicht 20 %. Das verändert die Art, wie man Unternehmen führt.
Die grundsätzlichen Fragen bleiben aber: Wie sieht meine Umsatzseite aus? Wie verdiene ich morgen mein Geld? Wie grenze ich mich vom Wettbewerb ab? Und wie sieht meine Kostenstruktur aus? Low-hanging fruits gibt es immer.
Was sich ebenfalls geändert hat, ist die Wettbewerbslandschaft. Vor 15 Jahren war China vor allem eine verlängerte Werkbank. Heute sind chinesische Wettbewerber technologisch in vielen Bereichen ebenbürtig, manchmal sogar überlegen. Kunden sagen dann: Die chinesische Maschine kann 80 % dessen, was unsere kann, kostet aber 50 %. Für 80 % der Kunden reicht das völlig. Diesen Wandel muss man verstehen und darauf reagieren.
Ist dieser Wandel in der Arbeitseinstellung eher ein gesellschaftliches oder ein politisches Thema?
Ich glaube nicht, dass man das trennen kann. Es ist beides. Gesellschaftlich hat sich das Verständnis von Belastbarkeit und Arbeitsbereitschaft verändert. Gleichzeitig gibt es politische Anreizstrukturen, die diese Entwicklung verstärken.
Daniel Stelter hat kürzlich eine Studie auseinandergenommen, die zeigen wollte, dass sich Arbeit immer lohnt. Am Ende blieben etwas mehr als 200 Euro pro Monat Unterschied. Pro Stunde waren das zwei Euro. Da muss man sich nicht wundern, wenn Menschen rational entscheiden und sagen, dass sich dieser Einsatz nicht lohnt. Dazu kommt die Möglichkeit, nebenbei über Schwarzarbeit nachzuhelfen. Es geht also um ein Zusammenspiel aus gesellschaftlicher Entwicklung und politischer Struktur.
Wie sieht Ihr Arbeitsalltag als CEO von Private Assets aus?
Wir sind kein riesiges Unternehmen und wie im Mittelstand üblich macht der Chef alles mit. Mein Arbeitsalltag ist sehr vielfältig. Ich bin stark in die Operations unserer Beteiligungen eingebunden und nah an den Themen in den Unternehmen.
Daneben beschäftige ich mich mit Akquisitionen, Finanzierung auf Corporate-Ebene und der Weiterentwicklung unserer Strategie. Je nach Jahreszeit verschieben sich die Schwerpunkte. Im Moment befinden wir uns etwa in der Budgetphase für 2026. Danach kommen Jahresabschlüsse, Halbjahresauswertungen und Investor-Relations-Themen.
Was sich stark verändert hat, ist die Präsenz vor Ort. Videokonferenzen ermöglichen es, viel mehr Termine in kürzerer Zeit wahrzunehmen und den Reiseaufwand zu reduzieren. Gleichzeitig gehen aber informelle Gespräche verloren, die fünf Minuten an der Kaffeemaschine, der Eindruck auf dem Shopfloor, das kurze Gespräch mit dem Betriebsratsvorsitzenden, das man nicht geplant hat. Genau dort entstehen oft entscheidende Hinweise.
Deshalb zwingen wir uns bewusst zu regelmässigen Vor-Ort-Besuchen, weil wir wissen, dass man nur so die Schwingungen eines Unternehmens wirklich aufnimmt.
Wenn Sie sich entscheiden müssten: Lieber die frühere Arbeitsweise mit viel Präsenz oder die digitalisierte Welt mit weniger Reisen?
Ich bin da ambivalent. Die digitale Welt ist effizienter. Man verliert nicht mehr einen ganzen Tag, um ein zweistündiges Meeting irgendwo in Deutschland abzuhalten. Das spart Ressourcen und Energie.
Gleichzeitig bleibt der persönliche Austausch unersetzbar. Der Rundgang durch die Produktion, das Gespräch im Büro, das spontane Treffen auf dem Flur, all das lässt sich nicht planen und passiert deshalb in Videokonferenzen nicht. Viele entscheidende Punkte entstehen erst im Gespräch, nicht in der Agenda. Deshalb braucht es beides.
Wenn man eine Private-Equity-Gesellschaft gründet, stellt sich schnell die Frage nach dem ersten Schritt: Beginnt man mit dem Team, mit den Investoren oder sucht man nach einer ersten Beteiligung? Was war Ihr erster Schritt?
Das hängt stark davon ab, welchen Ansatz man verfolgen möchte. Ich bin überzeugt, dass die Zukunft im Private Equity stark operativ geprägt ist. Reines Financial Engineering reicht nicht mehr. Deshalb braucht man operatives Know-how. Das kann über ein internes Team kommen oder über Partner, die man einbindet. Wovon ich nichts halte, ist erst Investoren zu suchen und dann Targets. Das erzeugt Investmentdruck. Wenn man Commitments eingesammelt hat, wollen die Investoren, dass man investiert. Dann kauft man unter Umständen Assets, die man sonst nicht gewählt hätte.
Ich war in der glücklichen Lage, dass wir erst eine Beteiligung hatten und danach das Team aufgebaut haben mit einer Mischung aus festen Mitarbeitern und Freelancern. Das hat uns erlaubt, organisch zu wachsen, ohne unter Druck zu geraten.
Wie gelingt es in der frühen Phase einer Private-Equity-Gesellschaft, attraktive Deals zu bekommen?
Fast ausschliesslich über persönliches Netzwerk. Wenn man 25 Jahre in der Restrukturierung unterwegs ist, kennt man sehr viele Menschen. Deals kommen dann über diese Kontakte.
Nach den ersten Transaktionen gelangt man automatisch auf die Verteiler der klassischen M&A-Berater. Aber einfach ein Büro anmieten und warten, dass Deals eintreffen, das wird nicht funktionieren. Der Markt ist zu kompetitiv.
Private Assets ist stark im Bereich der Distressed Assets tätig. Wie beeinflusst die gegenwärtige schwache gesamtwirtschaftliche Situation in Deutschland das Geschäft?
Zunächst einmal spüren wir die gleiche gesamtwirtschaftliche Entwicklung wie alle anderen auch. Unsere Beteiligungen sind oft Unternehmen mit strukturellen Herausforderungen oder geringer Ertragskraft. Wenn der Gesamtmarkt rückläufig ist, treffen diese Entwicklungen solche Unternehmen besonders stark.
Ein Unternehmen mit 20 % EBITDA-Marge übersteht einen Umsatzrückgang leichter als eines mit 3 %. Ein Turnaround gegen den Markt ist doppelt schwierig. Zudem bindet eine Krise sehr viel Management-Aufmerksamkeit. Themen, von denen man dachte, sie seien bereits sauber gelöst, kommen wieder auf den Tisch.
Auf der Einkaufsseite ist die Situation ambivalent. Man könnte meinen, es sei eine gute Zeit, um günstig zu kaufen, aber die Unsicherheit ist enorm. Viele M&A-Prozesse werden abgebrochen. Verkäufer sind unsicher, wie sich die Situation entwickeln wird. Manche hoffen kurzfristig auf eine Besserung und stoppen den Prozess. Andere merken, dass ihre ursprüngliche Preisvorstellung nicht mehr haltbar ist.
Wir sehen längere Laufzeiten und mehr abgebrochene Deals. In manchen Branchen rauschen Unternehmen direkt in die Insolvenz und wir sehen keinen Turnaround-Case mehr. Dann lassen wir es sein.
Die verarbeitende Industrie war lange das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Viele mittelständische Unternehmen geraten heute in Schwierigkeiten. Inwiefern trägt der Staat Verantwortung für diese Entwicklung und welche Massnahmen wären nötig um dies vorzubeugen?
Ich sehe die Verantwortung des Staates vor allem darin, wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Was der Staat nicht tun sollte, ist Industrien über Subventionen künstlich am Leben zu halten.
Viele der heutigen Probleme sind hausgemacht. Unternehmen brauchen vor allem Verlässlichkeit und Planungssicherheit. Zinsen kann man einpreisen, aber Planungsunsicherheit ist Gift. Wenn rechtliche und marktwirtschaftliche Rahmenbedingungen ständig verändert werden, verlieren Unternehmen die Basis für langfristige Entscheidungen. Deshalb glaube ich auch nicht, dass man heute noch von «Vorbeugen» sprechen kann. Wir sind mitten in der Krise.
Wir bräuchten einen klaren sanierungspolitischen Kurs, aber ich sehe diesen Mut politisch nicht. Man muss ehrlich anerkennen, dass man nicht gleichzeitig gegen Markt und Verbraucher argumentieren kann.
Wie bewerten Sie politische Massnahmen wie Zölle auf chinesischen Stahl oder Subventionen für grünen Stahl, die derzeit im Gespräch sind?
Das ist für mich der pyromanische Feuerwehrmann. Die Politik schafft die Probleme selbst und versucht dann, sie mit neuen Massnahmen zu bekämpfen. Die energieintensive Industrie in Deutschland ist nicht wettbewerbsfähig und das liegt zu grossen Teilen an der Energiepolitik. Grüner Stahl mag ökologisch sinnvoll erscheinen, aber ökonomisch wird er sich nicht rechnen.
Wenn man sagt, wir wollen ausschliesslich regenerative Energien, dann muss man gleichzeitig akzeptieren, dass der Strompreis hoch bleibt. Dann brauche ich auch keine Subventionen. Aber politisch versucht man, die Konsequenzen des eigenen Handelns abzufedern.
Wie blicken Sie auf einen Industriestrompreis?
Als Unternehmer in einer energieintensiven Branche würde ich sagen, grossartig. Realistisch betrachtet ist es Unsinn. Man braucht nur deshalb einen Industriestrompreis, weil man den eigenen Strommarkt dysfunktional gemacht hat. Die EEG-Umlage war ein Vorgeschmack darauf. Man schafft Strukturen, die zu hohen Preisen führen und versucht diese dann politisch zu bekämpfen.
Entweder man trifft eine Entscheidung und lebt mit den Konsequenzen, oder man lässt es gleich bleiben. Aber die Idee, international wettbewerbsfähigen Strom ausschliesslich über regenerative Energien zu erzeugen, ist unrealistisch.
Private Assets ist börsennotiert und arbeitet nicht mit einer klassischen Fondsstruktur. Wie kam es zu dieser Entscheidung und was bedeutet sie für den Alltag?
Wir haben 2019 intensiv über Fondsstrukturen nachgedacht. Im Small- und Mid-Cap-Segment machen Fonds aber erst ab einer gewissen Mindestgrösse Sinn. Eine Management-Fee von 2 % auf einen kleinen Fonds trägt die Struktur nicht.
Ähnlich ist es bei Anleihen. Die Platzierungskosten sind so hoch, dass sich das Modell erst ab 20 oder 25 Millionen Euro lohnt. Aber wenn man diese Summen einsammelt, entsteht sofort Investmentdruck.
Unsere Kaufpreise im Distressed-Segment bewegen sich typischerweise im sechsstelligen bis mittleren siebenstelligen Bereich. Ein grosser Fonds würde uns zwingen, viel schneller zu investieren, als wir es für sinnvoll halten. Deshalb finanzieren wir unsere Transaktionen heute weitgehend über Eigenkapital. Das gibt uns die Freiheit, auch einmal Nein zu sagen.
Allerdings bringt die Börsennotierung Pflichten mit sich: IFRS-Abschlüsse, klare Regulierungsstrukturen, Investor-Relations-Arbeit. Das ist aufwendig, aber handhabbar.
Viele grosse Private-Equity-Häuser nutzen aktuell Continuation-Fonds, weil klassische Exits ausbleiben. Spürt ihr diese Entwicklung auch im Small- und Mid-Cap-Segment?
Für uns stellt sich die Frage nicht, weil wir keine feste Haltedauer haben. Im Distressed-Bereich wäre das auch nicht sinnvoll.
Bei den grossen Fonds sehe ich zwei Gründe für diese Entwicklung. Erstens haben sich viele Portfolios nicht wie geplant entwickelt. Die Erwartungen vor fünf Jahren waren andere als die Realität nach Corona und geopolitischen Verwerfungen. Da versucht man über Continuation-Fonds Zeit zu gewinnen.
Zweitens finden viele Fonds schlicht keine Käufer. Die Volatilität ist hoch, sicher geglaubte Deals platzen häufiger. Manchmal ist der Fonds am Ende seiner Laufzeit und man muss eine Lösung finden, wie man mit der verbleibenden Beteiligung umgeht.
Für uns entstehen an dieser Stelle gelegentlich Opportunitäten, wenn wir letztere Beteiligungen günstig übernehmen können.
Sie haben betont, dass Financial Engineering allein nicht mehr ausreicht und operative Hebel wichtiger werden. Welche Kompetenzen sollten Berufseinsteiger mitbringen, die in Private Equity erfolgreich sein wollen?
Ich glaube nicht, dass es eine feste Formel gibt, aber operative Erfahrung wird immer wichtiger. Das gilt im Distressed-Bereich schon lange, betrifft aber zunehmend die gesamte Branche.
Es geht darum, Massnahmen nicht nur auf Papier zu formulieren, sondern sie auch umsetzen zu können. Viele Strategien scheitern nicht daran, dass sie schlecht sind, sondern daran, dass sie nicht implementiert werden.
Wer operativ gearbeitet hat, sei es in der Industrie, in einem Dienstleistungsunternehmen oder in einer entsprechenden Beratung, versteht besser, wie Unternehmen funktionieren. Das hilft im M&A-Prozess enorm.
Auch der Einzug von KI wird Prozesse verändern. Das ist kein IT-Thema, sondern ein Prozessthema. Und Prozesse bedeuten Menschen. Change-Management lernt man nicht in Excel.
Wo sehen Sie Private Assets in fünf Jahren?
Wir werden wachsen, da bin ich überzeugt. Krise kann anstrengend sein, aber sie macht auch Spass. Wir gehen davon aus, dass unser Wachstum stärker im europäischen Ausland stattfinden wird als in Deutschland, weil wir dort mehr Rückenwind sehen.
Unsere Organisation ist heute auf 15 bis 20 Beteiligungen ausgelegt. Mit zunehmender Internationalisierung werden wir stärker über Sprache, Kultur und die richtige Teamzusammensetzung nachdenken müssen. Gerade im Shopfloor ist Sprache zentral. Wir haben das in Spanien erlebt. Motivation über Dolmetscher funktioniert nur eingeschränkt. Diese Themen werden unsere Weiterentwicklung bestimmen.
Welchen Rat geben Sie Studierenden und Berufseinsteigern, die im Private Equity Fuss fassen möchten?
Breit aufstellen. Operative Einblicke sammeln. Internationale Erfahrung sammeln. Verstehen, wie Kulturen funktionieren und wie Menschen ticken.
Man braucht ein solides Fundament, aber man muss nicht überall Experte sein. Viel wichtiger ist es, Zusammenhänge zu verstehen. Wer nie gesehen hat, wie ein Buchungssatz aussieht, wird sich schwer tun. Und man muss verhandeln können. Das ist Psychologie und Menschenführung. Dafür hilft jede Erfahrung, die den Blick weitet.