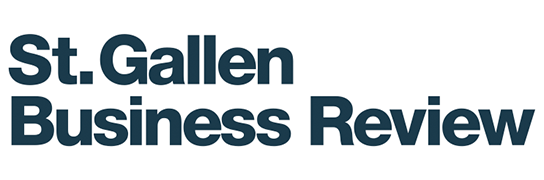Herr Gauck, Sie haben Physik in Deutschland und in den USA studiert und in Experimentalphysik promoviert. Könnten Sie uns einen kurzen Überblick geben, wie Ihr Weg zur Axpo, dem grössten Stromproduzenten in der Schweiz, verlaufen ist?
Mein Werdegang war nicht unbedingt geradlinig. Was mich immer geleitet hat, war die Frage: „Wo kann ich einen Unterschied machen und zu den Besten gehören?“ Während meiner Promotion in Experimentalphysik habe ich bemerkt, dass es Leute gab, die sich mit noch mehr Herzblut auf dieses Gebiet konzentrierten als ich selbst. Deshalb habe ich mich entschieden, in die Wirtschaft zu wechseln und bin für etwa fünf Jahre in die Unternehmensberatung gegangen. Eine Zeit, in der ich wieder unglaublich viel lernen durfte. Allerdings merkte ich dort erneut, dass ich nicht den Unterschied machen konnte, den ich mir vorgestellt hatte.
Ich habe mich dann den Finanzen in Verbindung mit der Energiewirtschaft zugewandt, eine Kombination, die mich sofort fasziniert hat. In dieser Schnittstelle konnte ich mich regelrecht wie ein Fisch im Wasser bewegen und zu neuen Höchstleistungen auflaufen. So habe ich als Divisions-Controller bei einem Mitbewerber in der Schweiz angefangen, wurde später Leiter Controlling und schliesslich CFO verschiedener Unternehmensteile bei der Axpo – konkret der Axpo Solutions. Nach sechzehn Jahren übernahm ich dann die Rolle des Group CFO beim Axpo Konzern. Es war zwar kein geradliniger Weg, aber für mich ging es immer darum, den Ort zu finden, an dem ich wirklich etwas bewirken kann. Ich bin überzeugt, genau das habe ich bei der Axpo gefunden.
Sie sind nun seit einem Jahr als Group CFO bei der Axpo tätig. Können Sie schon ein kurzes Zwischenfazit ziehen?
Es sind vor allem die Menschen bei der Axpo, die mich unglaublich faszinieren. Ich habe in diesem Jahr einen viel breiteren Einblick gewonnen als zuvor. Früher habe ich hauptsächlich mit Händlern, Originators, Mitarbeitern im Risk Management und Controllern im Handelsbereich zusammengearbeitet. Das war bereits sehr spannend, denn die Komplexität im Energiehandel ist wirklich hoch und bringt einen oft an die eigenen intellektuellen Grenzen – was ich grossartig finde.
Mittlerweile kommen jedoch viele andere Themen hinzu. Ich treffe zum Beispiel Finanzierungsexperten und Ökonomen sowie interne Projektleiter aus unserem internationalen Consulting-Team. Die Risikomanager auf Konzernstufe beschäftigen sich mit Enterprise Risk anstelle von Market- und Credit Risk. Und ich habe viel mit Projektentwicklern im Bereich Erneuerbare Energien zu tun, ebenso wie mit Kollegen aus der konventionellen und der nuklearen Produktion oder aus dem Netzbetrieb. Diese Vielfalt war für mich eine positive Überraschung. Ich dachte, ich würde schon einen erheblichen Teil des Unternehmens kennen, aber es gibt noch so viel mehr zu entdecken.
In dieser Branche ist es von immenser Bedeutung, dass Axpo finanziell sehr gut aufgestellt ist und über ein angemessenes Risikomanagement verfügt. Das haben wir in der europäischen Energiekrise um 2022 herum beweisen müssen und können. Wir sind gut aufgestellt – sowohl hinsichtlich Liquidität und Finanzierung als auch mit unserer Strategie und unserem Geschäftsmodell. Es macht wirklich Freude an diesem Ort sein zu dürfen.
War die Position des Group CFO bei der Axpo dabei schon immer Ihr langfristiges Ziel, oder hat sich das eher im Laufe der Zeit ergeben?
Eine gute Frage. Ich wollte grundsätzlich immer dort tätig sein, wo ich wirklich etwas bewirken kann. Anfangs war nicht klar, dass dies im Finanzbereich oder in einer Group-CFO-Rolle sein würde; es hätte ebenso eine kommerzielle Funktion sein können. Man muss verschiedene Dinge ausprobieren.
Als Unternehmensberater war ich im Front Office und nicht im Support-Bereich. Ich habe gemerkt, dass ich das zwar kann, aber andere darin noch besser sind. Das würde ich auch jedem als Empfehlung geben: probiert Verschiedenes aus. Was man sich mit 20 noch als perfekt vorstellt, muss nicht unbedingt mit 40 noch passen – denn man lernt sich selbst erst richtig kennen, und die Welt um einen herum verändert sich ebenfalls. Daher sollte man sich nicht zu früh festlegen. Hätte mir mit 20 Jahren jemand gesagt, dass ich einmal Group CFO eines grossen Schweizer Energieunternehmens sein würde, hätte ich das für völlig ausgeschlossen gehalten. Wir haben bereits die Energiekrise angeschnitten. Es lässt sich momentan vermuten, dass der Höhepunkt hinter uns liegt.
Wie sieht die Situation an der Strombörse aktuell aus, verglichen mit Herbst und Winter 2022?
Wenn man die Börse oder generell die Marktpreise betrachtet, stellen wir sofort fest, dass wir uns in einer völlig anderen Lage befinden. Im Vergleich zu vor der Energiekrise 2022 sind die Preise wieder leicht erhöht, aber längst nicht mehr so drastisch wie auf den Spitzenwerten, als sie zeitweise um den Faktor 20 über dem jetzigen Niveau lagen. Weiterhin ist die Marktvolatilität höher als damals.
Dennoch hat sich sehr viel geändert, wenn ich auf die letzten drei Jahre zurückblicke bis 2021. Der grösste Unterschied ist das fehlende russische Gas in Zentraleuropa. Russland lieferte damals jährlich rund 130bcm (billion cubic meters) Gas, was etwa 1‘300 Terawattstunden entspricht und zudem sehr flexibel war. Man konnte es einlagern und bei Bedarf mehr oder weniger flexibel abrufen. Inzwischen sind es nur noch 30bcm – es fehlen also 100bcm. Als Ausgleich wurden erneuerbare Energien ausgebaut und die LNG-Infrastruktur in Europa deutlich erweitert. Unter normalen Bedingungen bewegen sich die Preise aktuell in einem angemessenen Rahmen, und wir sehen keinen unmittelbaren Mangel. Allerdings sind die Fluktuationen stärker als früher durch die fehlende Flexibilität des russischen Gases. Zudem sind erneuerbare Energien ins Netz gekommen, die naturgemäss stochastisch sind. Ein Beispiel dafür ist die Dunkelflaute am 06. Nov. 2024 in Deutschland, als die Preise kurzfristig auf 800 Euro pro Megawattstunde stiegen – das ist immerhin der Faktor 10 eines „normalen“ Preises.
Es ist also nicht mehr alles wie früher. Unter normalen Bedingungen sieht es aktuell relativ stabil aus, und wir sind schon ein gutes Stück in den Winter hinein. Selbst wenn der Winter etwas kälter wird als prognostiziert, werden wir vermutlich gut durchkommen, allerdings könnte der Gasspeicherstand am Ende des Winters niedriger sein als im Vorjahr – es wird dann eine Herausforderung, die Speicher bis zum darauffolgenden Winter wieder zu füllen.
Umgekehrt bestehen Unsicherheiten, beispielsweise beim Gastransit durch die Ukraine, dessen Vertrag Anfang Januar ausläuft. Es ist noch nicht klar, wie es damit weitergeht. Auf der anderen Seite wird Ende 2025 mehr LNG verfügbar sein, was wieder für etwas mehr Planungssicherheit sorgen könnte. Im Moment (Dezember 2024) haben wir eine sehr ungewöhnliche Situation, dass das Sommergas für die nächste Saison fast so viel kostet wie das Wintergas. Normalerweise ist der Gasverbrauch im Winter deutlich höher, sodass winterliche Preise in der Regel höher sind als sommerliche. Also haben wir im Sommer jetzt diese ungewöhnliche Situation, die den eben genannten Gründen geschuldet ist. Aber was die Versorgungssicherheit betrifft, sieht es auf absehbare Zeit recht gut aus. Mittel- bis langfristig ist der Blick in die „Kristallkugel“ jedoch immer schwierig.
Wie wird sich der Energiemix von Axpo in den kommenden Jahren entwickeln, und welche konkreten Pläne verfolgt das Unternehmen?
In der Schweiz gibt es bestimmte Rahmenbedingungen, etwa den derzeit noch geltenden Ausstieg aus der Kernenergie. Die bestehenden Kernkraftwerke werden so lange betrieben, wie sie sicher sind. Beispielweise war bei Beznau zunächst eine Laufzeit von 50 Jahren vorgesehen, dann haben wir auf 60 und mittlerweile sogar 64 Jahre erhöht. Dieser Entscheid fiel unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Verantwortung sowie aufgrund von technischen, organisatorischen, regulatorischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Ähnlich könnte es auch bei den Kernkraftwerken Gösgen und Leibstadt aussehen. Langfristig werden diese Anlagen aber irgendwann vom Netz gehen. Wenn wir mit dem arbeiten, was uns zur Verfügung steht, ist vor allem die Windproduktion wichtig. Im Sommer verfügt die Schweiz bereits über genügend Energie durch Solarstrom. Solar im Winter ist allerdings schwieriger. Wir haben mit alpinen Solarprojekten versucht, voranzukommen, was sich aber aufwendiger gestaltet als erwartet – nicht nur für Axpo, sondern auch für andere Anbieter am Markt. Wir werden hier Fortschritte machen, wenn auch nicht in dem Umfang, den wir uns anfangs erhofft hatten.
Solar-Freiflächenanlagen sind in der Schweiz weniger leicht zu realisieren als im benachbarten Ausland, und Freiflächen im Mittelland bringen zudem nicht so viel Winterenergie. Windkraft hingegen liefert zwei Drittel ihrer Leistung im Winter und wäre daher eine sinnvolle Ergänzung zu Solarenergie und Wasserkraft. Wir sehen in der Schweiz Potenzial für etwa 10 Terawattstunden Windstrom pro Jahr. Technisch wäre mehr möglich, aber es gibt Restriktionen und nicht alle unterstützen den Ausbau der Windenergie. Obwohl Windenergie genau das wäre, was zusammen mit Solarenergie und anderen erneuerbaren Technologien einen guten Mix ergeben würde. Unser Szenario ist aktuell die Kernkraftwerke möglichst lange laufen zu lassen. Wenn die Lücke eines Tages entsteht, weil schliesslich nicht nur das Angebot sinken wird, sondern auch die Nachfrage durch Elektrifizierung wachsen wird, brauchen wir einen technologieoffenen Ansatz und einen gesellschaftlichen Konsens. Letztlich ist das auch ein Nachhaltigkeitsthema: Elektrifizierung, Wärmepumpen, E-Mobilität. Wir rechnen damit, dass der Bedarf von heute 60 TWh bis 2050 auf 90 TWh steigen wird. Wo wird es herkommen? Allein auf Importe zu setzen, wäre kurzsichtig. Zudem müssen wir klären, welche Rolle Gas spielen kann, vielleicht in Form von Reservekraftwerken für den Winter. Wenn wir den CO₂-Ausstoss insgesamt betrachten, kann eine gewisse punktuelle Gasnutzung verschmerzbar sein, solange wir gleichzeitig in grossem Umfang elektrifizieren. Es bleiben jedoch viele gesellschaftliche Fragen offen, wie die künftige Produktionslandschaft konkret aussehen soll.
Gleich dazu eine Anschlussfrage: In Deutschland wird derzeit diskutiert, ob die noch verfügbaren Kernkraftwerke weiter genutzt werden sollen. Wie stehen Sie zur Nutzung von Kernkraft?
Kernenergie braucht einen gesellschaftlichen Konsens. Sie ist mit Unwägbarkeiten verbunden – sowohl regulatorischer als auch wirtschaftlicher Natur. Da braucht es einen Konsens dafür, dass man die Kernenergie auch nutzen möchte. Aktuell kann man wahrscheinlich weltweit sagen, dass kein börsenkotiertes Unternehmen allein das finanzielle Risiko tragen könnte, ein neues Kernkraftwerk zu bauen und alle Risiken selbst zu schultern. Die Projekte sind einfach zu gross. Wir reden von Investitionen in der Grössenordnung von 15 Milliarden Franken und Laufzeiten von 70 Jahren. Dafür braucht es staatliche Garantien für gewisse regulatorische und wirtschaftliche Risiken. Das sieht man auch in anderen Ländern: Ein „Merchant-Kernkraftwerk“, das rein marktwirtschaftlich finanziert wird, entsteht derzeit nicht. Wenn dieser Konsens besteht, kann Kernenergie eine Möglichkeit sein, sichere und nahezu CO2-freie Energie zu produzieren. Preislich betrachtet muss man allerdings immer den gesamten Produktionsmix berücksichtigen. In der Schweiz etwa herrscht im Sommer kein Strommangel, was die durchschnittlichen Gestehungskosten für ein solches Kraftwerk weiter in die Höhe treiben würde. Es ist keine einfache Entscheidung. Axpo hat sich vorgenommen – und kürzlich auch auf unserer Bilanzmedienkonferenz bekannt gegeben –, eine Studie in Kooperation mit der Wissenschaft zu lancieren und Szenarien für die Schweiz ausarbeiten. Für den gesellschaftlichen Diskurs, wie zum Beispiel ganz konkret so eine Energiezukunft für die Schweiz aussehen könnte. Etwa mit einem starken Ausbau von Windenergie, mit Solarenergie, mit Gas oder mit Kernenergie. Es geht darum, konkreter zu beziffern, wie hoch etwa die Gestehungskosten eines neuen Kernkraftwerks wären und wo sowie in welchem Umfang Windkraftwerke errichtet werden könnten. Ziel ist es, eine plastische Vorstellung zu ermöglichen und nicht nur Meinungen zu äussern. Das ist eine grosse Aufgabe, der wir uns stellen wollen. Ab 2025 werden wir dies in Angriff nehmen.
Kommen wir noch einmal zurück zum Finanziellen. Axpo hat dieses Jahr eine Samurai-Anleihe1 in Japan platziert, was umgerechnet 250 Millionen Schweizer Franken entspricht. Was war der ausschlaggebende Grund, dies gerade in Japan zu tun?
Mir ist wichtig zu sagen, dass Axpo das eine tut aber nicht das andere lässt. Also wir meiden nicht den Schweizer Kapitalmarkt. Wir haben beispielswiese im Herbst eine Anleihe für die Kraftwerke Linth-Limmern AG begeben. Uns geht es eigentlich darum, unsere Finanzierung zu diversifizieren. Und das funktioniert am besten in guten Zeiten. Mit der Samurai-Anleihe1 konnten wir rund 20 neue Banken in unser „Bankenuniversum“ aufnehmen, mit denen wir nun Geschäftsbeziehungen pflegen. Sollten die Zeiten wieder stürmischer werden, stehen uns diese Institute an unserer Seite und ermöglichen uns, unsere Finanzierungsspielräume zu erweitern. Wichtig ist, dass man Diversifizierung nicht erst in stürmischen Zeiten anstrebt, sondern frühzeitig handelt. Genau das haben wir mit der Samurai-Anleihe getan. Die Platzierung in Yen war für uns ein Schritt, den wir bewusst gewählt und auch erfolgreich umgesetzt haben. Die 250 Millionen Franken entsprechen für uns einer normalen Ticketgrösse, und wir sind zufrieden, als „First Entrant“ diesen Markt erschlossen zu haben.
Eine kurze Nachfrage dazu: Entstehen durch die Platzierung einer Samurai-Anleihe Wechselkursrisiken, und wie geht Axpo damit um?
In der Finanzierung ist es üblich, die Anleihen zunächst variabel („floating“) aufzunehmen und sie anschliessend über einen Cross-Currency-Swap2 in die eigene Währung zu konvertieren. Dabei wird dann auch der Zins fixiert. Und genau so haben wir es gemacht. Axpo hat kürzlich zwei neue „Power Purchase Agreements“ (PPAs) mit Borealis abgeschlossen.
Welche strategische Bedeutung haben solche langfristigen PPAs für die finanzielle Stabilität und Planbarkeit von Axpo, und sehen Sie das Potenzial, diese Art von Verträgen in Zukunft noch weiter auszubauen?
Axpo steht dafür, Energielösungen für unsere Kunden zu suchen. Wir hören, was die Kunden brauchen, um ihre Energiebedürfnisse zu befriedigen, und prüfen, wie wir passende Lösungen bereitstellen können. Für Borealis bestand der Bedarf darin, langfristig Energie aus erneuerbaren Quellen zu beziehen. Wir haben auch andere Kunden, „Upstream-Produzenten“ erneuerbarer Energien, die gesicherte Cashflows für die Finanzierbarkeit ihrer Anlagen benötigen. Ihnen bieten wir langfristige PPAs für die Energieabnahme an. Axpo ist seit 2009 in diesem Markt mit PPAs aktiv – sowohl „Upstream“ als auch „Downstream“. Wir haben eine Diversifizierung von Märkten erreicht und verfügen über ein „Warehouse“, in das wir Energie aufnehmen können. Konkret bieten wir erneuerbaren Produzenten fixierte Preise an. Wir müssen dieses Risiko nicht sofort „back-to-back“ weitergeben, sondern können es durch unsere Diversifizierung und das sogenannte Proxy-Hedging3 an den Commodity-Märkten managen. Finden wir das passende Gegenstück oder einen Teil davon in unserem Portfolio, können wir unseren Kunden gute Preise anbieten – auch für langfristige Verträge – und die Energie in der gewünschten erneuerbaren Qualität liefern. Ein Teil unserer Unique-Selling-Proposition ist, dass wir dieses „Warehousing“ betreiben können. Wir müssen nicht beide Verträge wie ein Agent gleichzeitig abschliessen und durchreichen. Stattdessen können wir verschiedenen Bedürfnissen gerecht werden. Ein Produzent möchte vielleicht eine zehnjährige Bindung, um eine gute Finanzierung durch seine Bank zu sichern, während der Käufer einer „Hedging-Strategie“ folgen und die Preise nur für drei Jahre festlegen möchte. Als reiner Agent wäre es extrem schwierig, ein solches „Match“ herzustellen. Wir bieten mehr als nur Vermittlung, da wir auch Risikomanagement-Dienstleistungen anbieten. Dafür benötigen wir ein grosses Portfolio. Mit nur zwei Verträgen – einem auf der einen und einem auf der anderen Seite – wäre das Risiko viel zu gross. Mit einem grossen, diversifizierten Portfolio können wir solche Angebote machen und die Risiken „warehousen“ und „proxy-hedgen“, bis wir die passende Gegenseite gefunden haben. Das ist das Kerngeschäft dessen, was wir auf beiden Seiten tun. Aber es ist nicht das Einzige. Es geht darum, risikobasierte Lösungen für unsere Kunden zu finden.
Ist das Risikomanagement durch den Wegfall von russischem Gas schwieriger geworden, und gibt es aktuell mehr Risiko für Energieerzeuger und Zulieferer?
Mit der gestiegenen Preisvolatilität ist das sicherlich so. Während der Energiekrise 2022 gerieten viele Unternehmen in ernsthafte Schwierigkeiten. Das macht das Risikomanagement anspruchsvoller, weshalb wir verschiedene Massnahmen ergriffen haben – unter anderem eine Anpassung unserer „Hedging-Strategie“. Als Produzent mit wenigen Endkunden sind wir „long“ in Energie und verkaufen an den Terminmärkten, um unser Marktpreisrisiko zu reduzieren. Gleichzeitig entsteht dadurch ein Liquiditätsrisiko für den Konzern. Terminverkäufe sind besicherte Verträge, und bei Marktpreisschwankungen müssen Sicherheiten hinterlegt werden. Als die Preise damals aufgrund grosser Unsicherheiten stark stiegen, waren wir an den Grosshandelsmärkten kurzfristig „short“ und mussten zusätzliche Sicherheiten nachlegen. Diese wurden bei physischer Erfüllung wieder freigegeben. Das ist mittlerweile erfolgt. Dennoch müssen wir unser Liquiditätsrisiko besser steuern. Deshalb haben wir den „Hedging-Horizont“ verkürzt, um bei Preisausschlägen geringere Sicherheitsleistungen hinterlegen zu müssen. Unser gesamtes Portfolio ist nun weniger anfällig für Preisschwankungen. Es besteht aus verschiedenen Termingeschäften mit unterschiedlichen Laufzeiten und Commodities, vor allem Gas und Strom. In verschiedenen Zeithorizonten gibt es „Long-“ und „Short-Positionen“. Optimal aufgestellt ist man, wenn Sicherheiten aus bestimmten Verträgen abfliessen, während aus anderen gleichzeitig Liquidität zurückkommt. Hier haben wir uns im Vergleich zu vor drei Jahren deutlich verbessert.
Zudem analysieren wir in unserem Risikomanagement-System nun regelmässig Szenarien, die früher als unrealistisch galten – mittlerweile auf wöchentlicher oder sogar täglicher Basis. Eine weitere Massnahme war die Erweiterung und Verlängerung unserer Revolving Credit Facility im Februar 2024 auf über sieben Milliarden Euro. Damit sichern wir uns eine flexible Finanzierungsquelle für mehr Stabilität.
Wie genau ist die Eigentümerstruktur des Unternehmens organisiert, und inwiefern beeinflusst diese staatliche Beteiligung die strategischen Entscheidungen?
Die öffentliche Eignerstruktur der Axpo hat stets positive und negative Seiten. Da Axpo direkt oder indirekt den nordostschweizerischen Kantonen gehört, ergibt sich eine langfristige Perspektive. Ein börsenkotiertes Unternehmen muss quartalsweise Abschlüsse liefern, was das Management dazu bringen kann, kurzfristige Erfolge über langfristige zu priorisieren. Axpo hingegen kann auf diese quartalsweise Optimierung verzichten und eine langfristige Geschäftsstrategie verfolgen. Das ist die positive Seite. Die negative Seite ist die geringere Flexibilität bei kurzfristigen Änderungen. Während der Energiekrise war es für die Eigentümerschaft verständlicherweise nicht einfach, Axpo mit einer Eigenkapitalerhöhung zu unterstützen. Es gibt also sowohl Vorteile als auch Nachteile, die stets gegeneinander abgewogen werden müssen.
Plant Axpo eine weitere Internationalisierung?
Einen weiteren Internationalisierungsschritt würden wir zu gegebener Zeit entscheiden und kommunizieren. Wichtig ist, dass er wirklich passt. Wir bewegen uns in regulierten Energiemärkten und sind auf liberalisierte Strukturen angewiesen. Zudem brauchen wir ein zuverlässiges Rechtssystem und stabile Rahmenbedingungen, wie wir sie in Europa kennen. Nur so können wir unseren Kunden in andere Märkte folgen und dort vergleichbare Risiken – einschliesslich regulatorischer und rechtlicher Risiken – managen. Das schliesst viele Optionen aus, die für Unternehmen in anderen Branchen denkbar wären. Sollte sich jedoch eine passende Gelegenheit ergeben, würden wir sie prüfen, entscheiden und entsprechend kommunizieren.
Wie bewerten Sie die staatlichen Investitionen in den schnellen Ausbau der LNG-Infrastruktur während der Energiekrise? Hätten diese Mittel besser in erneuerbare Energien fliessen sollen?
Der Ausbau erneuerbarer Energiequellen ist unumgänglich, und wir müssen in diese Richtung weitergehen. Gleichzeitig muss unser Energiesystem jedoch resilient gegenüber äusseren Einflüssen bleiben, die ausserhalb unserer Kontrolle liegen – etwa Dunkelflauten. Solange wir Kernenergie nutzen, kann es auch vorkommen, dass Reaktoren, wie 2022 in Frankreich, nicht verfügbar sind. Der Krieg in der Ukraine führte zudem zu einem erheblichen Gasdefizit. Deshalb brauchen wir Optionen im System, mit denen wir reagieren können, wenn es nicht wie erwartet läuft. Diese Optionen haben ihren Preis – eine Optionsprämie, die gezahlt wird. Läuft alles nach Plan, ist sie verloren. Wenn es jedoch nicht wie erwartet läuft, war es möglicherweise eine wertvolle Absicherung. Als Gesellschaft müssen wir den richtigen Mix finden: das tun, was im Erwartungsfall sinnvoll ist, aber gleichzeitig resilient genug sein, um auf unerwartete Entwicklungen reagieren zu können.
Der Schweizer Strommarkt ist teilliberalisiert. Wie stehen Sie persönlich zu einer vollständigen Liberalisierung des Schweizer Strommarkts?
Dieser teilliberalisierte Markt in der Schweiz hat aus meiner Sicht keine Zukunft. Ein vollständig liberalisierter Markt ist das, was wir anstreben müssen. Aktuell sind Kunden an Stadtwerke oder Gemeindewerke gebunden, die möglicherweise ein schlechtes Risikomanagement oder fehlerhafte Verbrauchsprognosen haben, was zu Ausgleichsenergiezahlungen führt, die auf die Kunden abgewälzt werden. Diese Kunden haben keine Möglichkeit, schlechte Anbieter abzustrafen und zu solchen zu wechseln, die günstigere oder innovativere Produkte bieten. Hier sind viele Möglichkeiten denkbar, etwa eine Spotindizierung oder Angebote, die E-Mobilität, Wärmepumpen und PV-Anlagen besser unterstützen als Standardtarife. Dass solche Optionen heute nicht möglich sind, ist aus meiner Sicht problematisch. Angesichts der zunehmenden Volatilität der Energiemärkte, der schwer vorhersehbaren Dunkelflauten und der stochastischen Produktion benötigen wir mehr Flexibilität und Innovation. Teilliberalisierung bremst diese Entwicklung. Der Schritt zu einem vollständig liberalisierten Markt ist längst überfällig.
Was motiviert Sie persönlich als CFO von Axpo, eine zentrale Rolle in der Energiewende zu übernehmen?
Wie ich vor über 25 Jahren begann, mich mit der Energiewirtschaft zu beschäftigen, war das für viele ein wenig attraktives Feld. Ich fand es jedoch sehr attraktiv, da Energiehandel und Energiewirtschaft generell sehr komplex und intellektuell fordernd sind. Wenn wir über „Origination“ sprechen, also die Bedienung von Individualkundenbedürfnisse mit Risikomanagementlösungen, dann reden wir eigentlich von strukturierten Produkten. Der Energiehandel ist auch faszinierend: Jede Stunde wird am Ende einzeln gehandelt. Die Faszination der Energiewirtschaft liegt auch darin, was ich den Moment der Wahrheit nenne, wenn sich das, was man vor Jahren geplant hat, realisiert. Ich habe ein Terminprodukt, man beginnt drei Jahre im Voraus, irgendwann sind es zwei Jahre, dann Produkte für Year Ahead, Quartal, Monat, Woche, Tag, Day Ahead und schliesslich Stunden und Viertelstunden, bis die physische Erfüllung eintritt. Da ist man im Spotmarkt, wo Angebot und Nachfrage direkt gematcht werden. Und das ist dann auch wirklich einer Fundamentalanalyse zugänglich. Damit das Stromnetz stabil ist, müssen Stromproduktion und Stromverbrauch jederzeit übereinstimmen. Deshalb sind alle Lieferanten resp. ihre sogenannten Bilanzgruppen verpflichtet, ausreichend Strom einzukaufen oder zu produzieren, um den ihnen zugeordneten Verbrauch zu decken. Sie müssen «ausgeglichen» sein und das jeweils Viertelstunden-scharf. Faszinierend – da kann man wirklich viel Zeit und Freude hineinstecken. Früher sprach man von Versorgern, wenn man die Energiewirtschaft ansprach, und das hat viele nicht interessiert. Heute hat sich das jedoch völlig gewandelt. Wenn wir heute Stellen besetzen wollen, bekommen wir Lebensläufe von Profilen, die wir früher nie gesehen haben. Es ist schön zu sehen, dass sich immer mehr Menschen dafür begeistern, Teil der Energiewende zu sein. Die Rolle der Energiewirtschaft hat sich von einem Mauerblümchen zu einer der interessantesten Branchen überhaupt entwickelt.
Welchen Rat würden Sie jungen Menschen geben, die heute eine ähnliche Laufbahn anstreben?
Ich bin überzeugt, es ist wichtig, neugierig zu bleiben, verschiedene Dinge kennenzulernen und offen zu sein, seinen eigenen Weg zu finden. Den Unterschied machen zu können, oder, wenn man es anders ausdrücken will, zu den Besten im Feld zu gehören, ist entscheidend. Das hilft einem, jeden Morgen die Energie zu finden, aufzustehen. Man schwimmt dann nicht in der Mediokrität mit, sondern kann wirklich einen Unterschied machen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, sich mit Kolleginnen und Kollegen zu vernetzen. Nicht als Einzelkämpfer unterwegs zu sein, sondern Teams zu bilden, von anderen zu lernen und sich inspirieren zu lassen.
Was die Energiewirtschaft betrifft, ist das Faszinierende, dass es so unglaublich viele verschiedene Rollen gibt. Ich habe es zu Beginn angesprochen: von den Rollen im Energiehandel, wie Trader, Originator, Risikomanager und Controlling, über das Netz bis hin zu den Hydro- und Kernkraftwerken und den Erneuerbaren. Dort gibt es die Projektleiter, die Visionen umsetzen und realisieren. Diese Vielfalt in der Energiewirtschaft ist einzigartig und macht es besonders leicht, offen zu bleiben und unterschiedliche Dinge zu lernen. Das fällt hier vielleicht noch leichter als in anderen Branchen.