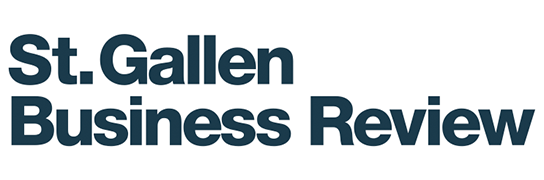Disclaimer: Dieses Gespräch wurde bereits am 29. November 2024 geführt.
In Ihrem Buch schreiben Sie „Die Studienwahl […] ist mir nicht leichtgefallen. Jura und Politikwissenschaften sowie ein Medizinstudium reizten mich”. Was hat Sie am Schluss dazu bewogen, ein Wirtschaftsstudium vorzuziehen?
In meiner Abitur- oder Maturazeit habe ich mich sehr stark für politische und gesellschaftliche Themen interessiert. Ich begann, nicht nur den Sportteil zu lesen, sondern auch Artikel über Wirtschaft und Politik. Dabei wurde mir bewusst, dass mir vieles nicht vertraut war – insbesondere fehlte mir das Verständnis für zahlreiche Fachbegriffe. Das lag auch daran, dass ich ein humanistisches Gymnasium besucht habe, wo ich Latein und Altgriechisch lernte, jedoch keinen Unterricht in Buchhaltung oder Volkswirtschaftslehre hatte.
Mich hat immer fasziniert, was die Welt im Innersten zusammenhält. Natürlich sind das die Naturgesetze, aber auch ökonomische und politische Entwicklungen. Daher lag ein Wirtschaftsstudium für mich nahe. Besonders die Volkswirtschaftslehre hat mich sehr interessiert, weil bedeutende Themen wie Länderrisiken, Arbeitslosigkeit, Inflation oder Zahlungsbilanzen immer mit diesem Fachgebiet zu tun haben. Das hat mich gefesselt, und ich bin diesem Themenbereich bis heute treu geblieben.
In Deutschland wird derzeit wieder über die Wiedereinführung einer allgemeinen Dienstpflicht diskutiert. Sie selbst haben 4 Jahre Ihres Lebens im Militär verbracht. Welche Erkenntnisse haben Sie aus dieser Zeit mitgenommen, die Ihnen später in Ihrer Karriere geholfen haben, und welche Vorteile könnte eine solche Erfahrung aus Ihrer Sicht jungen Menschen heute bieten?
In der Schweiz waren ein militärischer Rang und beruflicher Erfolg lange Zeit sehr eng verknüpft. Das hat sich inzwischen geändert. Früher gab es in der Armee noch rund 800.000 Soldaten, heute sind es nur noch etwa 100.000 – ein großer Unterschied. Unabhängig davon hat man bereits mit 19 oder 20 Jahren gelernt, Teams zu führen – und das unter widrigen Bedingungen, Tag und Nacht, mit großem Schlafmangel, bei Regen, Schnee und Kälte. Das hat einen gut abgehärtet und gezeigt, wie Leadership funktioniert, insbesondere wenn man ein Team aus fast gleichaltrigen Menschen führt.
Während der Finanz- und Schuldenkrise habe ich erlebt, dass diejenigen mit militärischer Ausbildung, die den Führungsrhythmus des Militärs verinnerlicht hatten, sich sehr gut geschlagen haben. Daher halte ich die militärische Ausbildung für eine hervorragende Schule für Leadership. Allerdings sind auch die Opportunitätskosten zu bedenken. Wer immer höhere militärische Aufgaben übernimmt und vier Jahre im Militär verbringt, hätte diese Zeit natürlich auch für einen Aufenthalt in Asien oder Lateinamerika nutzen können.
In meinem Fall konnte ich alles andere nachholen, aber ich war immer der Meinung, dass man nie etwas Irreversibles tun sollte. Das ist vielleicht ein schwieriger Begriff, aber ich meine damit, dass man sich alle Optionen offenhalten sollte und das tut, was man später als wertvoll erachtet und wofür man später keine Gelegenheit mehr haben wird.
Das gilt für das Schreiben einer Doktorarbeit, für eine militärische Ausbildung und natürlich auch für Auslandsaufenthalte. Wenn man solche Dinge nicht mit 20 oder 25 macht, dann ist es oft zu spät.
Sie persönlich haben den Leitspruch „Leistung aus Leidenschaft” bei der Deutschen Bank etabliert. Welche Bedeutung hat dieser Spruch für Sie persönlich?
Zunächst einmal der Ausgangspunkt, wie wir bei der Deutschen Bank dorthin gekommen sind: In nur wenigen Jahren haben wir es geschafft, von einer wenig profitablen Bank in die Spitzengruppe der globalen Investmentbanken aufzusteigen. Viele Top-Manager großer Banken weltweit haben gesagt: „Ihr seid die Einzigen, die das geschafft haben.“ Und ich habe mich gefragt: Was ist in Deutschland so besonders, dass uns das gelungen ist?
In einer Vorstandssitzung meinte dann jemand: „Ich glaube, wir haben einfach eine „Passion to Perform.“ Und das trifft es genau. Ich bin überzeugt, dass man das, was man tut, mit Freude, Begeisterung und echtem Enthusiasmus anpacken muss. Dieser Antrieb, etwas zu leisten,
zu gestalten und zu bewegen, war bei uns besonders ausgeprägt. Das ist auch eine Haltung, die mich persönlich immer begleitet hat. Anstatt mit 20 schon über die Altersvorsorge nachzudenken oder sich auf den fürsorgenden Staat zu verlassen, sollte man mit Eigenverantwortung und Selbstvertrauen sagen: „Ich will etwas bewegen.“ Diese Einstellung hat mich mein ganzes Leben lang geprägt.
Was würde eine mögliche Übernahme der Commerzbank durch Unicredit für Deutschland bedeuten, insbesondere für den Mittelstand? Und wie kann sich Deutschland langfristig wieder stärker positionieren, wenn eine der zentralen deutschen Banken ins Ausland gehen würde?
Als ich noch bei der Credit Suisse arbeitete, wollten wir einmal eine österreichische Bank übernehmen. Damals gab es großen Widerstand in Österreich, insbesondere in Wien, mit der Aussage: „Wir wollen nicht, dass die österreichischen Kredite am Paradeplatz in Zürich entschieden werden. Und jetzt höre ich wieder dasselbe: „Wir wollen nicht, dass die Kredite
in Mailand entschieden werden.“
Das zeigt mir zwei Dinge. Erstens, dass wir immer noch nicht europäisch denken, sondern sehr stark national geprägt sind. Wenn wir ein geeintes Europa schaffen wollen, ist es essenziell, dieses nationale Denken endlich zu überwinden.
Zweitens basiert diese Haltung auf der Annahme, dass eine grenzüberschreitende Übernahme das Geschäft schrumpfen lässt – dabei ist meistens genau das Gegenteil der Fall. Eine stärkere Bank, die eine andere übernimmt, will wachsen, Gewinne erzielen, Erträge steigern und Marktanteile ausbauen.
Zur Einordnung: Unicredit ist in Bezug auf Gewinn und Marktkapitalisierung heute doppelt so groß wie die Deutsche Bank – ein bezeichnendes Beispiel für ihre Größe. Ich halte es zudem für falsch, dass sich die Politik in solche Entscheidungen einmischt. Das zeigte sich bereits
damals, als Vodafone Mannesmann übernehmen wollte. Kanzler Schröder sprach sich dagegen aus, während Tony Blair klarstellte, dass sei eine Sache der Wirtschaft und der Aktionäre. Am Ende entscheiden die Aktionäre: Wenn sie ein Angebot attraktiv finden, stimmen sie zu. Wenn nicht, lehnen sie es ab – und genau so sollte es sein.
Ich vertraue darauf, dass der Markt das regelt. Als mittelständischer Kunde hätte ich jedenfalls keine Sorge, keinen Kredit zu bekommen – im Gegenteil. Möglicherweise wären die Konditionen sogar vorteilhafter, da die Cost-Income-Ratio einer Unicredit deutlich niedriger ist als die einer Commerzbank.
Sie bezeichneten Trump 2017 als ein „Experiment, bei dem man sehen müsse, was herauskommt.” Da wir vor einer zweiten Amtszeit stehen, wie sehen Sie die Rolle Europas in einer Welt, die von „America First”-Politik und einem Wirtschaftskonflikt
zwischen den USA und China geprägt ist? Welche strategischen Schritte wären aus europäischer Sicht notwendig, um in diesem Spannungsfeld bestehen zu können?
Ich spreche jetzt als jemand, der lange in der EU gelebt hat und nicht nur als Schweizer – wobei die Schweiz natürlich auch zu Europa gehört. Als Schweizer habe ich keinen Grund, irgendetwas zu beurteilen. Aber als Europäer ist es einfach klar, dass wir alles tun müssen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und Europa wieder zu einem innovativen und effizienten Wirtschaftsraum zu machen.
Es ist noch sehr viel zu tun! Es wird weniger konsumiert und investiert. Wir kämpfen überall mit Bürokratie, Überregulierung, hoher steuerlicher Belastung und Energieabhängigkeit – nicht zu vergessen die hohen Energiekosten. Das sind gewaltige Themen, die uns beschäftigen. Und dazu kommt ein riesiges Defizit in der Verteidigungsfähigkeit.
Es ist für mich schon manchmal bemerkenswert, dass wir immer wieder warnen, Trump oder die Amerikaner könnten die Unterstützung für die Ukraine reduzieren. Die Amerikaner haben 350 Millionen Menschen, wir in Europa 450 Millionen. Eigentlich müssten wir sagen: Dann machen wir es eben selbst und strengen uns mehr an. Ich glaube, dass Trump – den ich immer noch als Experiment bezeichnen würde – eines auslösen wird: Der Druck auf Europa, endlich erwachsen zu werden, wird zunehmen. Und das, denke ich, ist etwas Gutes für Europa.
Welche kurzfristigen wirtschaftlichen Folgen hätte die angekündigte pauschale Zoll-Erhöhung von 15–25 % auf Waren aus Mexiko, Kanada, China? Wann wären diese in Europa spürbar, beispielsweise für Unternehmen wie VW, die aus Mexiko heraus exportieren?
Natürlich bin ich als Marktökonom entschieden gegen solche Zölle, da sie hohe Kosten verursachen – auch für die eigene Bevölkerung. Letztlich glaube ich jedoch nicht, dass es so drastisch kommt. Trump stammt selbst aus der Wirtschaft und agiert als Dealmaker. Er wird mit massiven Forderungen in die Verhandlungen gehen, und irgendwann wird man eine
Lösung finden. Ich habe gerade gelesen, dass Christine Lagarde einen guten Vorschlag gemacht hat: Wir sollten auf die Amerikaner zugehen und Gespräche führen, um die kommenden Probleme anders anzupacken. Ich glaube, darauf wartet er.
Er wird den Druck erhöhen, um einen größeren Beitrag zur Verteidigung der Welt zu fordern, was ich richtig finde und als Amerikaner auch so sagen würde. Für die Schweiz denke ich, dass wir das, was wir schon einmal unter Trump hatten, wieder aktivieren sollten – eine Art Freihandelsabkommen. Trump war diesbezüglich eigentlich ganz offen. Es ist zwar an der Landwirtschaft gescheitert, aber diese trägt nur etwa 0,5 % zum Bruttosozialprodukt bei.
Das muss man ernst nehmen und man muss eine Lösung finden. Aber für den Rest der Wirtschaft wäre ein Raum, in dem wir von Zöllen verschont bleiben, natürlich viel wichtiger. Da muss man jetzt kreativ werden. 2025 wird definitiv ein Jahr der Disruptionen werden, das ist klar. In allen Ländern, vor allem in Amerika, aber auch sicher in Deutschland.
Sie haben sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland bedeutende Führungspositionen innegehabt. Welche kulturellen und geschäftlichen Unterschiede zwischen beiden Ländern haben Sie in Ihrer Karriere besonders wahrgenommen, und
inwiefern haben Sie diese Unterschiede in Ihren Führungsstil integriert?
Aus meiner Perspektive gibt es kaum einen Unterschied, wenn wir auf die Menschen schauen. Die jungen Absolventen, die gerade von den Hochschulen kamen, waren in beiden Ländern deutlich besser ausgebildet als wir zu unserer Zeit, insbesondere in Bereichen der Finanzmathematik und den neuen Finanzprodukten. Sie können auch viel besser in Englisch
kommunizieren. Das war in Deutschland nach dem Krieg ein großes Problem, dass eine ganze Generation mehrheitlich nicht gut Englisch konnte. Im globalen Kontext führte dies zu größeren Herausforderungen als für die heutige Generation, für die dieses Thema mittlerweile abgehakt ist. Auch in der Leistungsbereitschaft sehe ich keinen Unterschied. Ich fand die Deutschen, gerade die jungen Leute, die von der Hochschule kamen, außerordentlich leistungsorientiert, sehr produktiv und innovativ.
Der große Unterschied liegt in der Corporate Governance, da in der Schweiz die Aufgabenteilung zwischen Aufsichtsrat, Verwaltungsrat, Vorstand und Geschäftsleitung anders gestaltet ist und zusätzlich die Mitbestimmung eine wichtige Rolle spielt. Ich habe auch den Eindruck, dass es aus der Politik heraus in Deutschland ein stärkerer Fokus auf den
fürsorgenden Staat gibt, der fast unantastbar ist. Das habe ich immer als großen Unterschied empfunden. In der Schweiz haben wir eine gesunde Skepsis gegenüber dem Staat, während in Deutschland der fürsorgende Staat eine viel größere Rolle spielt.
Was ich auch erlebe, ist die Idee des Wettbewerbs in der Schweiz – sei es Steuerwettbewerb von Gemeinde zu Gemeinde oder der Wettbewerb zwischen Universitäten. In Deutschland hingegen gibt es viel mehr ein Harmoniedenken und eigentlich keinen Wettbewerb in diesem
Sinne. Das war für mich ein kultureller Unterschied. Ein weiterer großer Unterschied betrifft die Governance. In der Schweiz haben wir eine sehr starke Idee von Teamarbeit mit einer klaren Spitze, während in Deutschland mehr das Team im Vordergrund steht. Der Vorstand ist in
Deutschland gemeinschaftlich verantwortlich, während bei uns die Führungsfunktion des CEO im Zentrum steht. Das ist ein gravierender Unterschied, den wir besonders in Zusammenarbeit mit angelsächsischen Mitarbeitern oft erklären mussten. Es wird allerdings in der Praxis immer mehr anders gelebt, als es effektiv im Gesetz steht. Heute ist man in
Deutschland auch eher in einer CEO-Struktur.
Früher war es bei der Deutschen Bank jedoch sehr verschieden. Am Anfang war ich wie meine Vorgänger nicht CEO sondern Vorstandssprecher und zwar sprichwörtlich der Sprecher des Vorstandes. In manchen angelsächsischen Kreisen war das immer etwas amüsant, weil dann Leute sagten, sie wollten den CEO und nicht die Spokesperson of the Board treffen, den man als Head of Communication hielt. Das mussten wir irgendwie anpassen. Es war auch immer so, dass der Sprecher nicht unbedingt der Chef war. Ich erinnere mich gut, als ich zur Deutschen Bank kam, sagte mein Vorgänger, dass er das und das so wollte. Dann sagte ein Vorstandsmitglied: „Mein Lieber, Sie sind nicht unser Chef, Sie sind unser Sprecher.“ Dies unterscheidet sich von der gängigen Praxis in der Schweiz, wo ein anderer Ansatz verfolgt wird. Wir sind hier in der Schweiz viel mehr angelsächsisch geprägt.
Was war der Hintergrund der Entscheidung, das Primus-inter-Pares-Prinzip zu ändern und dem CEO besondere Vorrechte einzuräumen?
Weil vor allem die angelsächsischen Mitarbeiter eigentlich einen klaren Chef haben wollten – einen CEO. Natürlich muss man auch sagen, dass die Medien immer mehr auf diesen Punkt fokussieren. Ob man das nun gerne hat oder nicht, ist eine andere Frage, aber der CEO wird immer mehr zur zentralen Figur. Er ist der Sprecher des Unternehmens und gibt die Strategie vor. Diese Personifizierung ist heute sehr ausgeprägt. Man kann das schade finden, aber das bedeutet nicht, dass man intern kein starkes Team hat. In Deutschland, als ich noch kam, war der ganze Vorstand bei „Sie“, obwohl sie schon zehn oder zwanzig Jahre zusammengearbeitet haben.
Ich habe häufig Wochenenden mit dem Vorstand verbracht und schließlich vorgeschlagen, innerhalb des Vorstands zum vertraulichen ‚Du‘ überzugehen. Das war ein ziemlicher Kulturschock für Deutschland, während man in der Schweiz im täglichen Kontakt deutlich unmittelbarer ist. In Deutschland war das sehr formell. Das hat sich, glaube ich, auch geändert, vor allem mit der jungen Generation.
Sie haben in Ihrer Karriere nicht nur wirtschaftliche Krisen durchlebt, sondern auch persönliche Herausforderungen, wie etwa die Konflikte bei der SKA, die zu Ihrem Austritt führten. Wie gehen Sie persönlich mit solchen Krisen um, und welche Strategien helfen Ihnen, schwierige Situationen zu bewältigen?
Erstmal hilft Selbstvertrauen, dass man auch neue Wege einschlagen kann. Wenn man mit etwas nicht zufrieden ist, kann man immer sagen: „Ja, ich mache da mit und mache dann eben Karriere.“ Oder man sagt eben: „Nein, ich gehe meinen Weg und tue, was ich für richtig halte.“
Heutzutage stellt das Thema Burnout und Panikattacken, insbesondere bei jungen Menschen, ein erhebliches Problem dar. Als ich hierherkam, hörte ich im Radio, dass ein Drittel der Mitarbeiter in der Schweiz sich irgendwie belastet fühlt. Das sind unglaubliche Zahlen. Oft werde ich gefragt, ob ich solche Phänomene auch kenne, und ich sage immer: „Nein“, aber ich nehme das sehr ernst, weil mir bewusst ist, dass es jeden treffen kann.
Ich habe mir immer vier, fünf Leitsätze gemerkt, die mir helfen. Der erste ist, relativ gesund zu leben und Sport zu treiben, auch Ablenkung zu suchen. Der zweite ist, einen intakten Familien- und Freundeskreis zu pflegen, der einem auch frühzeitig Empfehlungen gibt oder einen freundlich kritisiert, damit man nicht abhebt. Der dritte Leitsatz: Was man macht, muss man mit Freude machen. Ich schaue immer gerne Musikern zu, die ihr Instrument mit Begeisterung spielen und nicht verkrampfen. Das soll auch im Berufsleben gelten. Man muss sich freuen, etwas zu bestimmen und zu kreieren. Und viertens, was Sie eben angesprochen haben: Wenn man das Gefühl hat, jetzt bin ich in einer Situation, in der ich mich nicht wohlfühle, dann muss man auch den Mut haben, zu wechseln und etwas Neues zu suchen. Der fünfte Leitsatz ist, dass man auch Hobbys pflegen sollte – also Interessen, die bereichernd sind und auch etwas Neues bringen, sodass man nicht ganz abhängig ist. Aber das A und O ist, dass man den eigenen Fähigkeiten vertraut. Das ist das Allerwichtigste.
Warum nehmen Burnouts in der heutigen Gesellschaft immer mehr zu?
Ich weiß es nicht. Natürlich ist diese ständige Berieselung durch Social Media und das kontinuierliche Sich-Messen mit Ikonen wahrscheinlich nicht gut. Das hatten wir früher weniger. Wir konnten früher schon öfter mal abschalten. Deshalb ist es wichtig, dass man von Zeit zu Zeit eine Auszeit nimmt und das Handy beiseitelegt. Früher, als wir Reisen gemacht haben, war man einfach nicht erreichbar. Als ich ein kleines Kind war, musste man das Telefonat mit unseren Verwandten in den USA anmelden; bspw. samstags um 11 Uhr konnte man anrufen. Heute ist es unglaublich, wie schnell man jederzeit jemanden erreichen kann, sowohl aktiv als auch passiv.
Manchmal frage ich mich auch, ob man nicht ein bisschen mehr an sich selbst arbeiten sollte und die Selbstverantwortung wieder stärker betonen müsste. Wenn man an die Bankchefs denkt: UBS, Deutsche Bank – das sind alles keine Akademiker. Man muss nicht immer den Druck ausüben, dass man unbedingt studieren und einen Abschluss haben muss. Wenn man dafür nicht geschaffen ist und mit diesem Druck nicht umgehen kann, ist es viel besser, Dinge zu tun, die einem Freude bereiten. Zu sagen: „Ich will keinen Studienabschluss, ich will ein tolles Geschäft aufbauen, ein Handwerk oder einen kaufmännischen Beruf.“ Und damit kann man glücklich werden – übrigens verdient man dabei auch oftmals mehr Geld.
Bei der Führungserfahrung bleiben wir zunächst. Ein Punkt, den ich auch ansprechen möchte: Wenn man eine Führungsposition innehat, eckt man an. Spätestens dann muss man sich fragen, ob man weitermachen will. Es ging sogar so weit, dass ich eine
Beschwerde erhielt. Die Frage stellt sich dann, wie man weiter macht. Wie geht man mit Widerstand um? Ich sage dann: „Okay, das war der Abschluss, ich lasse es jetzt.“ Geht es darum, trotzdem dabei zu bleiben?
Wie geht man weiter, wenn man eine Führungsposition hat und auf Widerstand stößt? Wenn ein paar Journalisten etwas Kritisches schreiben, muss man das, glaube ich, einfachwegstecken. Das zeigt auch, dass man etwas bewegt hat. Wichtig ist, wie das Umfeld darauf reagiert – sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik. Man muss immer differenzieren. Es
gibt einen großen Unterschied zwischen der veröffentlichten und der öffentlichen Meinung.
Als ich zum Beispiel sagte, dass es für mich eine Schande wäre, Staats- oder Steuergeld anzunehmen – nicht für mich persönlich, sondern für die Bank – gab es einen Shitstorm in den Medien. Bis hin zu Frau Merkel, die meinte, „Nehmen Sie doch auch, das ist solidarisches Verhalten.“ Wir haben dann eine Umfrage mit Allensbach gemacht, und 80 Prozent der
Deutschen waren der Meinung, dass das vollkommen richtig war. Das zeigt, wie unterschiedlich die Meinungen sein können.
Ich glaube, wenn einem die Küche zu heiß ist, sollte man nicht Koch sein. Und wenn man Koch sein will, muss man es auch wirklich wollen. Merkel hat kürzlich gesagt, man muss Chef sein wollen. Und das ist natürlich richtig: Man muss Chef sein wollen, und dann muss man sich nicht scheuen, das zu tun, was man für richtig hält, und daran festhalten. Vieles, was kurzfristig kritisiert wird, wird langfristig als richtig erkannt.
Wenn ich heute in Deutschland bin, nächste Woche in Berlin, und die Leute immer noch interessiert sind, was man sagt, liegt das daran, dass man immer für etwas steht – auch für eine Richtung. Ich glaube, das wird jetzt ganz entscheidend in der Politik. Ich habe letzte Woche in einem Interview gesagt, dass man in Deutschland sehr viel bewegen kann, wenn
jemand einen klaren Kompass hat und die richtige Führung vorlebt. Ich hoffe sehr, dass dies in Deutschland gelingt. Dann bin ich viel optimistischer für Deutschland als viele andere.
Deutschland ist ein emotionales Volk. Schauen Sie sich doch den Fußball an: Drei Spiele verloren, und man ist schon zu Tode betrübt. Dann gewinnt man dreimal, und man ist schon wieder Weltmeister. Diese Volatilität ist für mich unglaublich. Aber ich habe das in Deutschland immer erlebt: Deutschland ist zu Unglaublichem fähig, wenn man Vertrauen in die Führung hat. Und ich hoffe, Merz schafft das.
Was machen Sie aktuell, und was motiviert Sie noch?
Natürlich bin ich in vielen Bereichen aktiv, auch im philanthropischen Sektor. Zudem bin ich als Beirat oder Chairman des Beirats in verschiedenen Bereichen tätig, teilweise auch im Banking. Wir haben eine virtuelle Investmentbank gegründet, in der ehemalige Mitarbeiter der Deutschen Bank ein globales Netzwerk aufgebaut haben, in dem wir selbstständig operieren. Das Netzwerk besteht aus fast 200 ehemaligen Mitarbeitern.
Ein weiteres Engagement von mir ist im Bereich der Behandlung von Depressionen, wo ich sowohl als Investor als auch beratend in München tätig bin. Darüber hinaus bin ich finanziell engagiert und als Chairman des Advisory Boards in einem Bereich aktiv, der an der Entwicklung eines dreidimensionalen Internets arbeitet. Dieses Projekt ist bereits sehr weit
fortgeschritten, und es umfasst unter anderem Chips und andere Technologien.
Es gibt diesen Spruch: „Learn, earn, return.“ Ich sage immer, Lernen hört nie auf. Eigentlich sollte man sich jeden Tag bemühen, noch etwas Neues zu lernen. „Earn“ nimmt mit der Zeit vielleicht etwas ab, hört aber nie ganz auf. Und „return“ ist etwas Schönes, wenn man auch etwas zurückgeben kann. Deshalb habe ich bereits insgesamt rund dreieinhalb Millionen
Schweizer Franken für St. Gallen zur Verfügung gestellt – für den Lehrstuhl und auch für das Binswanger Fellowship.
Man muss sich immer wieder bewusst machen, dass man nie aufhören sollte zu lernen. Wenn ich mit 77 Jahren sagen würde, ich höre auf zu lernen, wäre das schlimm. Man würde sehr schnell alt werden, wenn man das aufgibt. Man muss sich bemühen, am Leben und an neuen Ideen dranzubleiben.
Ich war letztes Jahr auf einer Technologiekonferenz in Berlin und saß auf einem Panel. Als ich die anwesenden jungen Technikbegeisterten beobachtete, dachte ich mir: „Mein Gott, wie jung die alle sind.“ Es war ziemlich spannend. Nach dem Panel kamen viele auf mich zu und wollten Selfies machen. Sie fragten mich weniger nach technischen Details, die ich sowieso nicht beantworten kann, sondern mehr nach Fragen des Lebens an sich. Es ist einfach wichtig, den Kontakt zu jungen Menschen zu halten, diese Perspektiven zu erleben und zu sehen, wie sie die Welt gestalten wollen. Das ist ein wertvoller Austausch, der mich immer wieder motiviert.
Welchen Rat würden Sie einem Bachelor-Absolventen für seinen weiteren Weg geben?
Ich glaube, ich würde schnell in einen Beruf einsteigen. Eine Studienreise kann selbstverständlich unternommen werden, jedoch ist dies auch zu einem späteren Zeitpunkt möglich. Ich habe während des Studiums einige Monate in den USA verbracht, was eine wertvolle Erfahrung war.
Für mich ist es wichtig, sich in der Karriere von anderen abzuheben, indem man Dinge tut, die nicht jeder macht. Zum Beispiel, indem man ein Konzept freiwillig erarbeitet und es präsentiert. Ich habe damals auch Bücher über verschiedene Produkte geschrieben. Das hatte zwei Vorteile: Erstens habe ich selbst viel dabei gelernt, und zweitens zeigt es, dass man bereit ist, mehr zu tun, als nur von acht bis fünf im Büro zu sitzen.
Ein weiteres wichtiges Element ist, ein starkes Team zu bilden. Man sollte nie allein arbeiten, sondern immer im Team. Bei der Deutschen Bank war ich sehr stolz darauf, dass wir zehn Jahre lang mit praktisch demselben, vertrauten Team gearbeitet haben. Das finde ich äußerst wichtig, weil so ein Vertrauensverhältnis entsteht. Man kennt die Stärken und Schwächen der anderen und ist offen zueinander. Ich bin persönlich kein Freund vom ständigen Wechseln, sondern glaube an die Stabilität und das Vertrauen, das man in einem langfristigen Team aufbaut.
In der heutigen globalisierten Welt ist zudem eine multikulturelle Neugierde relevant. Und schliesslich sollte man nie vergessen, dass der Arbeitsinhalt befriedigender ist als die Vergütung.